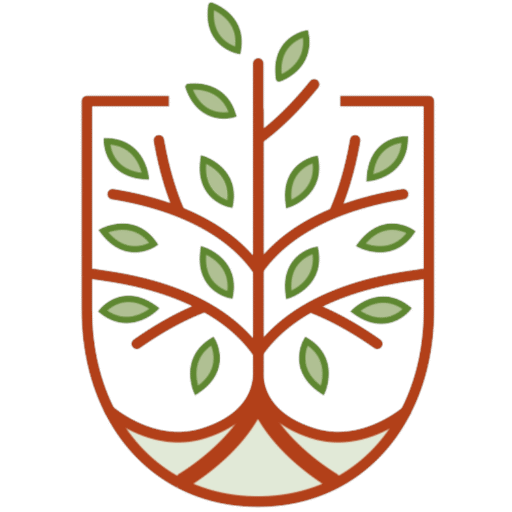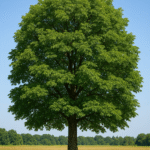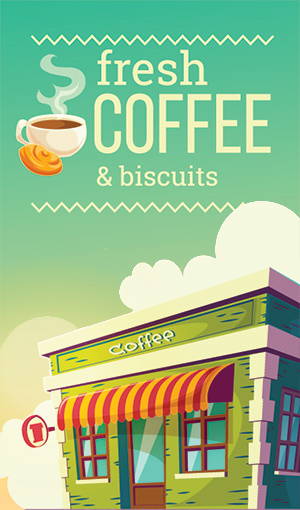Ohne wirksamen Wildschutz sind Aufforstungen oft zum Scheitern verurteilt. Gerade junge Bäume sind besonders anfällig für Verbiss- und Fegeschäden. Mechanische Schutzsysteme bleiben daher unverzichtbar – selbst in Zeiten, in denen auch Alternativen wie chemische Mittel oder Einzelschutzsysteme diskutiert werden.
Hordengatter haben sich dabei als besonders zuverlässige Lösung erwiesen. Vor allem in schwierigen Lagen – etwa bei hoher Wilddichte, auf exponierten Sturmflächen oder in Regionen mit regelmäßigem Schneebruch – bieten sie stabilen Flächenschutz. Durch ihre modulare Bauweise sind sie zudem flexibel einsetzbar und lassen sich an unterschiedliche Standorte anpassen.
Materialwahl und Vorbereitung
Ein Hordengatter besteht aus wenigen, aber robusten Komponenten:
- Standleisten als tragende Pfosten
- Querlatten zur seitlichen Stabilisierung und zum eigentlichen Verbissschutz
- Befestigungselemente wie Nägel oder Schrauben, bei Bedarf ergänzt durch Sturmanker
Die Materialwahl entscheidet wesentlich über Haltbarkeit und Aufwand. Holzarten wie Lärche oder Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Fäulnis besonders geeignet. Trotzdem gilt: Im direkten Bodenkontakt verkürzt sich die Lebensdauer. Daher sollten Standleisten möglichst sorgfältig dimensioniert und gesetzt werden.
Vorbereitung ist entscheidend:
- Die Elemente müssen vor dem Einbau trocken gelagert werden, um Verformungen oder frühe Schäden zu vermeiden.
- Der geplante Zaunverlauf sollte vorher abgesteckt werden. Dabei gilt es, Kurven, Geländestufen und mögliche Durchgänge oder Zufahrten zu berücksichtigen. Eine gute Planung spart beim Aufbau Zeit und verhindert spätere Nacharbeiten.
Aufbau Schritt für Schritt
- Platzierung und Ausrichtung der Standleisten: Sie bilden das Gerüst und müssen gleichmäßig gesetzt werden. Ein fester Stand ist essenziell, gerade in lockerem Boden oder an Hanglagen.
- Montage der Querlatten: In der Regel werden 3–4 Latten im Verband angebracht. Dabei werden die Latten versetzt genagelt oder geschraubt, sodass eine stabile, versetzte Struktur entsteht.
- Einsatz von Sturmankern: In wind- oder schneereichen Regionen empfiehlt sich eine zusätzliche Sicherung. Sturmanker verhindern, dass ganze Elemente kippen oder aus dem Boden gedrückt werden.
- Modulweise Erweiterung: Der Aufbau erfolgt in einzelnen Segmenten, die flexibel ergänzt oder bei Bedarf zurückgebaut werden können. Diese Bauweise erleichtert Reparaturen, wenn einzelne Abschnitte beschädigt werden.
Spezielle Einbausituationen
a) Hanglagen
- Hier wirken zusätzliche Querbelastungen, weshalb eine zusätzliche Verankerung sinnvoll ist.
- Gleichzeitig muss auf eine funktionierende Drainage geachtet werden: Staut sich Wasser, leidet sowohl die Stabilität des Gatters als auch das Pflanzenwachstum.
b) Rückegassen und Maschinenzufahrten
- Da forstliche Arbeiten meist langfristig geplant sind, sollten rückbaubare Durchfahrten oder Torelemente eingeplant werden. So bleibt die Bewirtschaftung auch nach dem Zaunbau möglich.
c) Schneebruchgefährdete Lagen
- Das Gatter sollte mit genügend Abstand zu bestehenden Bäumen gesetzt werden, damit herabfallende Äste keinen Dominoeffekt auslösen.
- Außerdem ist wichtig, dass keine einzelnen Module unter Spannung stehen: Bricht ein Element, soll der Schaden nicht auf die gesamte Konstruktion übergreifen.
Logistik und Arbeitsaufwand
Ein Vorteil von Hordengattern liegt im vergleichsweise geringen logistischen Anspruch:
- Jedes Element wiegt rund 18 kg und kann von einer Person transportiert werden.
- Schweres Gerät ist nicht erforderlich – ein klarer Pluspunkt bei empfindlichen Standorten oder in Nasslagen, wo Bodenschonung entscheidend ist.
- Die Elemente lassen sich gut an Waldrändern oder Zwischenlagerstellen zwischenlagern, bevor sie im Gelände aufgebaut werden.
Damit bleibt der Aufbau auch für kleinere Teams oder Waldbesitzende mit begrenztem Personaleinsatz handhabbar.
Fazit
Hordengatter sind eine robuste, bewährte und zugleich umweltverträgliche Lösung für den Schutz junger Wälder. Mit der richtigen Materialwahl, sorgfältiger Vorbereitung und standortgerechtem Einbau lassen sie sich effizient errichten und über Jahre hinweg nutzen.
Besonders in naturnahen Aufforstungsprojekten ohne spätere Rückbaupflicht spielen sie ihre Vorteile voll aus: Sie verbinden Stabilität mit Flexibilität, benötigen keine schweren Maschinen und lassen sich an unterschiedliche Geländebedingungen anpassen.
Wer heute in wirksamen Wildschutz investiert, schafft die Grundlage dafür, dass Aufforstungen nicht nur gelingen, sondern auch nachhaltig Bestand haben.