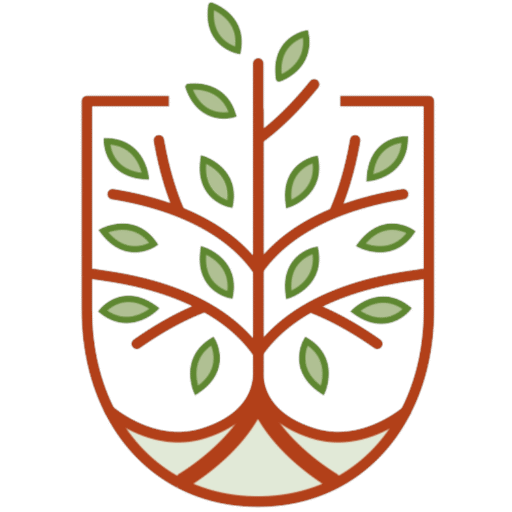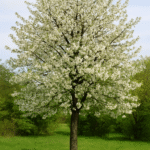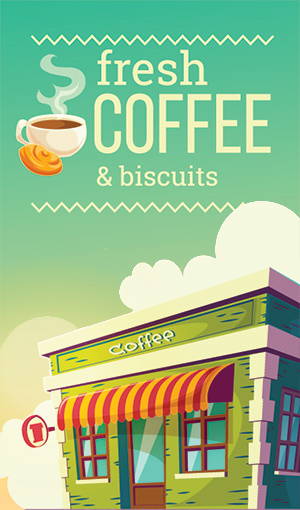Wenn von Wildschäden im Wald die Rede ist, denken viele zuerst an Verbiss. Doch ebenso gravierend – und oft noch folgenreicher – sind Fege- und Schälschäden. Gerade bei wertvollen Laubbäumen können sie den langfristigen Erfolg von Aufforstungen massiv gefährden.
Ob Eiche, Ahorn oder Lärche: Bäume, die für einen stabilen, klimaangepassten Waldumbau entscheidend sind, stehen besonders im Fokus von Reh- und Rotwild. Deshalb gilt: Wer Aufforstungen plant, sollte den Schutz vor Fege- und Schälschäden von Anfang an mitbedenken.
Was sind Fege- und Schälschäden?
Fegeschäden entstehen durch Rehwild. In der Zeit des Geweihaufbaus reiben Böcke die Basthaut am Geweih an jungen Stämmchen ab. Was für das Tier eine biologische Notwendigkeit ist, bedeutet für den Baum eine gravierende Verletzung: Die Rinde wird abgeschabt, die Leitungsbahnen beschädigt und Krankheitserreger können eindringen. Häufig führt das zu Wachstumsstörungen oder sogar zum Absterben.
Schälschäden werden meist vom Rotwild verursacht. Hierbei wird die Rinde in breiten Bahnen vom Stamm gezogen – nicht selten bis zur Ringelung, die den Baum vollständig vom Nährstofffluss abschneidet. Auch wenn er überlebt, bleibt der Baum entwertet, weil das Holz durch Pilze oder Fäule unbrauchbar wird.
Besonders gefährdet sind: Eiche, Ahorn und Lärche. Sie bieten für Wild attraktive Oberflächen und sind für die forstliche Nutzung zugleich besonders wertvoll.
Wann und wo treten diese Schäden auf?
- Fegeschäden: Typisch sind die Perioden April–Mai und August–September, wenn das Geweih wächst oder gefegt wird. Betroffen sind vor allem flexible, junge Bäume mit glatter Rinde.
- Schälschäden: Häufen sich im Winter, wenn das Nahrungsangebot knapp ist. Rotwild nutzt die Rinde dann als Ersatznahrung.
Risikoflächen:
- Waldränder und Übergänge zum Offenland
- Einzelpflanzungen und Baumgruppen
- Bereiche entlang von Wildwechseln
Wer diese Risikozonen kennt, kann gezielter vorbeugen und Schutzmaßnahmen priorisieren.
Folgen für den Bestand
Fege- und Schälschäden sind nicht nur kosmetische Schäden, sondern gravierende Eingriffe in die Bestandsentwicklung:
- Einzelverluste mit hohem Wert: Gerade Bäume mit guter Qualität und Zukunftsperspektive gehen verloren.
- Sekundärinfektionen: Pilze wie Rotfäule dringen über Verletzungen ein und breiten sich unkontrolliert aus.
- Verformungen und Stockausschläge: Aus dem geraden Stamm wird schnell ein krummer, minderwertiger Baum.
- Verlust der Zielgeraden: Besonders im Waldumbau zählt die Qualität einzelner Laubbäume. Geht diese verloren, sind Jahrzehnte an Entwicklungszeit umsonst.
Was hilft gegen Fege- und Schälschäden?
Ein wirksamer Schutz ist möglich – allerdings nur, wenn er gezielt auf Fege- und Schälschäden ausgerichtet ist.
- Einzelschutz mit geschlossenen Hüllen: Sie verhindern den direkten Kontakt von Reh- oder Rotwild mit der Rinde. Gerade bei wertvollen Einzelpflanzungen ist das die wirksamste Lösung.
- Mechanische Barrieren: Spezielle Konstruktionen wie die dreieckige Form der Tree Shield-Hülle erschweren es Rehböcken, in den Schutz „einzusteigen“. So werden Fegeschäden von Anfang an ausgeschlossen.
- Keine Drahtspiralen: Sie schützen nur eingeschränkt und bieten Rehböcken oft genug Ansatzpunkte zum Reiben.
- Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Rotwildbesatz: In stark frequentierten Revieren kann es sinnvoll sein, Schälvorbeugung durch Alternativangebote oder lenkende Fütterung zu ergänzen.
Fazit
Wer beim Wildschutz ausschließlich an Verbiss denkt, greift zu kurz. Fege- und Schälschäden treten oft erst dann auf, wenn die Pflanzen bereits angewachsen sind – und der Schaden besonders teuer wird.
Ein durchdachtes Schutzsystem berücksichtigt deshalb alle Wildwirkungen, nicht nur die sichtbarsten. Für den erfolgreichen Waldumbau gilt: Besser vorbeugen, als wertvolle Jahre an Baumwachstum zu verlieren.