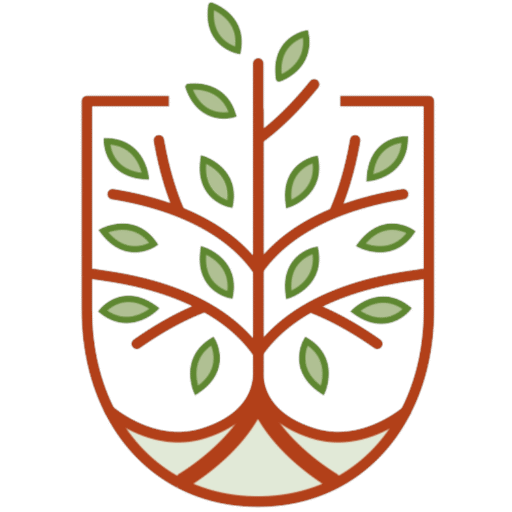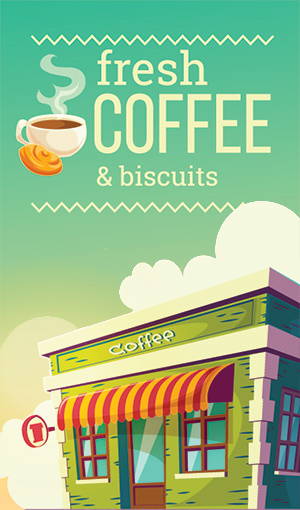Vom Aufbau zur Wirklichkeit
Viele Schutzsysteme sehen in der ersten Woche nach dem Aufbau stabil und überzeugend aus. Doch die eigentliche Bewährungsprobe folgt später: Was passiert nach zwei Wintern, nach Sturmereignissen oder Schneebruch, bei steigendem Wilddruck und beginnender Vegetationskonkurrenz?
Dieser Erfahrungsbericht beleuchtet typische Entwicklungen und teilt Praxiserfahrungen – mit dem Ziel, anderen Waldbesitzenden und Praktiker:innen eine Orientierung bei der Wahl der Schutzsysteme zu geben.
Rückblick: Aufbaubedingungen und Standorte
Die getesteten Schutzsysteme wurden unter unterschiedlichen Bedingungen eingesetzt:
- Regionen und Standorte: Von Hanglagen mit zusätzlicher Windlast bis zu frostgefährdeten Mulden sowie Waldinnenlagen und exponierten Außenrändern.
- Aufbauzeitpunkte: Teils im Frühjahr direkt zur Pflanzzeit, teils im Herbst mit Vorbereitung auf den Winter.
- Pflanzgut: Mischung aus Einzelpflanzungen (z. B. wertvolle Laubbäume) und Flächenaufforstungen mit Mischbaumarten.
Diese Transparenz ist wichtig, denn die Ausgangsbedingungen bestimmen maßgeblich, wie sich die Systeme entwickeln.
Hordengatter nach 1–2 Jahren
Standfestigkeit: In der Regel zeigen sich Hordengatter auch nach Stürmen und Schneelasten robust. Einzelne Standleisten können sich jedoch lockern, insbesondere in weichen Böden oder an Hanglagen.
Zustand der Materialien: Nach zwei Jahren sind erste Witterungsspuren sichtbar – leichtes Quellen und Verfärben des Holzes. Verbindungselemente halten in der Regel, punktuell sind kleinere Reparaturen notwendig.
Bewuchs: Häufig setzen sich Brombeeren oder andere konkurrenzstarke Pflanzen am Zaunfuß durch. Gleichzeitig wachsen junge Bäume im Schutzbereich oft schon durch die Konstruktion hindurch.
Wirksamkeit: Verbiss innerhalb der Fläche war selten, allerdings kommt es an offenen Enden oder nicht vollständig geschlossenen Segmenten zu Wilddruck.
Bilanz: Bewährt hat sich eine modulare Bauweise, die Reparaturen erleichtert. Nachjustierungen sind in wind- und schneereichen Regionen einzuplanen.
Einzelschutz (biologisch abbaubare Wuchshüllen) nach 1–2 Jahren
Zersetzung: Erste Auflösungserscheinungen zeigen sich meist erst nach zwei Jahren – die Hüllen sind oft noch weitgehend intakt. Das ist positiv, da die Schutzwirkung anhält.
Stabilität: In ebenem Gelände stehen die Hüllen stabil. In Hanglagen oder bei starkem Wind kann es zum Kippen kommen, wenn sie nicht sorgfältig fixiert wurden.
Pflanzenentwicklung: Geschützte Bäume zeigen deutlich höheres Höhenwachstum und profitieren vom günstigeren Licht- und Mikroklima.
Typische Fehler: Zu tief eingeschlagene Hüllen behindern die Belüftung, schlecht gebundene Exemplare neigen zum Umfallen, und bei zu engen Hüllen droht Verformung des Stammes.
Bilanz: Bei sachgerechtem Aufbau sind die Systeme wirksam und zugleich ressourcenschonend. Fehler beim Einbau wirken sich allerdings sofort auf den Schutz aus.
Wartung und Pflege – wie hoch ist der Aufwand wirklich?
- Nachjustieren: Sowohl Hordengatter als auch Hüllen erfordern punktuell Kontrolle. Besonders nach Sturmereignissen oder starkem Schneefall ist ein Kontrollgang sinnvoll.
- Reparaturen: Bei Hordengattern treten Reparaturen häufiger auf, insbesondere bei lockeren Standleisten oder beschädigten Querlatten. Einzelschutzhüllen benötigen meist nur dann Eingriffe, wenn sie mechanisch beschädigt oder schlecht gesetzt sind.
- Vergleich zu Draht: Klassische Drahtsysteme hätten nach zwei Jahren bereits Rückbauarbeiten erfordert – ein zusätzlicher Aufwand, der bei biologisch abbaubaren Hüllen entfällt.
Fazit: Was hat sich bewährt – und für welche Situationen?
- Hordengatter: Sehr robust auf größeren Flächen, insbesondere dort, wo Naturverjüngung geschützt werden soll.
- Einzelschutzhüllen: Effektiv für punktgenauen Schutz wertvoller Einzelpflanzen und kleine Pflanzgruppen, mit geringerer Folgelast.
Die Empfehlung lautet: Die Wahl des Systems sollte immer standortgerecht erfolgen, angepasst an Wilddruck, Bewirtschaftungsziel und Geländeverhältnisse.
Ausblick
Die Beobachtungen werden weitergeführt, um Aussagen auch für längere Standzeiten zu treffen. Geplant ist, die Entwicklung der biologisch abbaubaren Hüllen über die gesamte Zersetzungsphase hinweg zu dokumentieren und die Standfestigkeit der Hordengatter nach weiteren Extremwintern zu überprüfen.
Wer ähnliche Erfahrungen gesammelt hat, ist herzlich eingeladen, diese zu teilen – der Austausch unter Praktiker:innen ist ein entscheidender Baustein, um den Waldumbau gemeinsam erfolgreich zu gestalten.