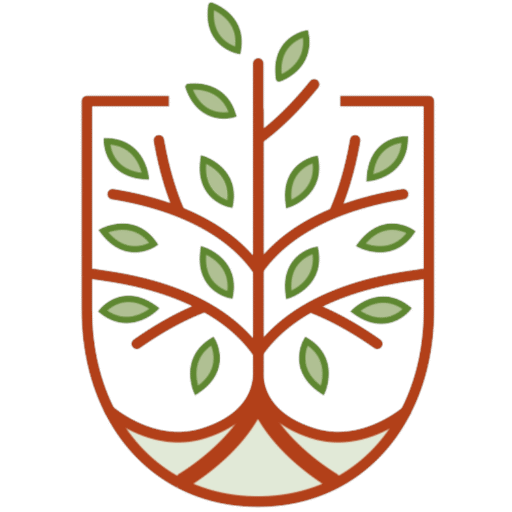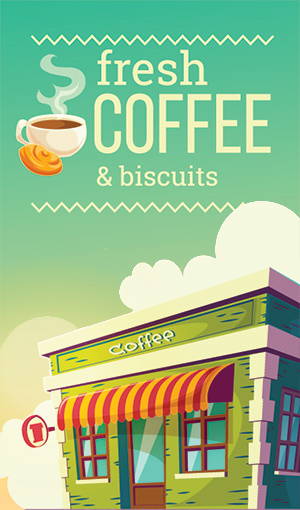Klimaanpassung ist längst kein theoretisches Schlagwort mehr, sondern eine dringende Notwendigkeit. Dürresommer, Schädlingswellen und Stürme haben gezeigt, wie verletzlich unsere Wälder sind. Die Bundesregierung hat darauf reagiert: Mit einer neuen Förderung des BMEL werden Waldbesitzende unterstützt, die über gesetzliche Standards hinausgehen und ihre Wälder aktiv klimaangepasst bewirtschaften.
Doch was heißt das konkret im Alltag eines Forstbetriebs oder für private Waldbesitzer:innen? Ein Blick auf die zwölf Kriterien macht deutlich, wie praxisnah der Ansatz gedacht ist – und wo Schutzmaßnahmen eine Schlüsselrolle spielen.
Warum klimaangepasstes Waldmanagement heute entscheidend ist
Die letzten Jahre haben gezeigt: Wälder in Deutschland sind massiv unter Druck. Dürreperioden, Schädlingsbefall und Windwürfe haben große Schadflächen entstehen lassen. Ein reines „Weiter so“ ist keine Option mehr.
Ziel des Waldumbaus ist es, resiliente, gemischte und anpassungsfähige Wälder zu schaffen. Die Förderung eröffnet Waldbesitzenden die Möglichkeit, bereits bestehende Maßnahmen abzusichern und neue Schritte finanziell abgesichert umzusetzen.
Die zwölf Kriterien im Überblick – und was sie konkret bedeuten
1. Verjüngung mit Planungsvorlauf
Verjüngung darf nicht erst dann beginnen, wenn Lücken entstehen. Frühzeitige Vorausverjüngung sorgt für einen nahtlosen Übergang der Altersklassen und vermeidet Brüche in der Bestandesentwicklung.
2. Naturverjüngung bevorzugen – aber klimaresilient
Naturverjüngung ist kostengünstig und standortangepasst. Sie darf jedoch nicht unkontrolliert erfolgen: Oft ist eine gezielte Ergänzung durch klimaresiliente Arten erforderlich.
3. Angepasste Baumarten bei Pflanzung
Die Auswahl geeigneter Arten richtet sich nach Empfehlungen der forstlichen Landesanstalten. Nur Baumarten, die als klimastabil und standortgerecht gelten, sollen gepflanzt werden.
4.–5. Sukzession und Mischbaumarten zulassen
Natürliche Entwicklungen haben ihren Wert: Sukzession kann zu standortgerechten Beständen führen, wenn man sie begleitet. Gleichzeitig sollen Mischbaumarten aktiv eingebracht werden – etwa Traubeneiche, Kiefer oder Esskastanie.
6. Verzicht auf Kahlschläge
Kahlschläge sind nur im Schadensfall erlaubt. Auch dann soll ein Anteil von Totholz verbleiben, um Biodiversität zu fördern.
7.–8. Mehr Totholz und Habitatbäume
Selbst in Wirtschaftswäldern gilt: Strukturen schaffen Stabilität. Totholz und Habitatbäume sichern Lebensräume und erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems.
9. Rückegassen mit größerem Abstand
Weniger Befahrung bedeutet weniger Bodenverdichtung. Gesunde Böden sind Grundlage für gute Anwuchsbedingungen und langfristige Stabilität.
10. Verzicht auf Dünger und Pflanzenschutz
Chemische Eingriffe sind tabu – mit Ausnahme notwendiger Borkenkäfer-Polterbehandlungen. Die Fläche selbst bleibt unbehandelt.
11. Wasserrückhalt fördern
Klimaanpassung heißt auch: Wasser im Wald halten. Alte Entwässerungen sollten gestoppt oder zurückgebaut werden, um den Wald gegenüber Starkregen wie auch Dürre widerstandsfähiger zu machen.
12. 5 % natürliche Waldentwicklung
Große Betriebe sind verpflichtet, 5 % ihrer Flächen stillzulegen. Kleinere (<100 ha) können dies freiwillig tun – ein Beitrag zu Biodiversität und langfristiger Stabilität.
Was bedeutet das für Aufforstung und Jungbestandsschutz?
Alle Kriterien haben eines gemeinsam: Sie setzen junge Bäume ins Zentrum. Ohne stabile Verjüngung sind weder Artenwahl noch Wasserrückhalt langfristig erfolgreich.
Gerade in der Phase der Verjüngung ist der Wildverbiss oft der limitierende Faktor – nicht der Klimastress. Daher braucht es wirksame Schutzmaßnahmen wie Einzelschutzsysteme oder Hordengatter, damit Jungbestände überhaupt die Chance haben, klimaresilient zu werden.
Fazit
Die zwölf Kriterien zeigen: Nachhaltigkeit im Wald ist machbar – wenn sie praxisnah geplant und konsequent umgesetzt wird. Wer klimaangepasst handelt, handelt vorausschauend.
Tree Shield unterstützt Waldbesitzende dabei: mit Wissen aus der Praxis und Schutzsystemen, die den Erfolg von Aufforstungen sichern, ohne später zusätzlichen Rückbauaufwand zu verursachen. Denn am Ende zählt nicht nur, welche Bäume gepflanzt werden – sondern ob sie auch geschützt groß werden.