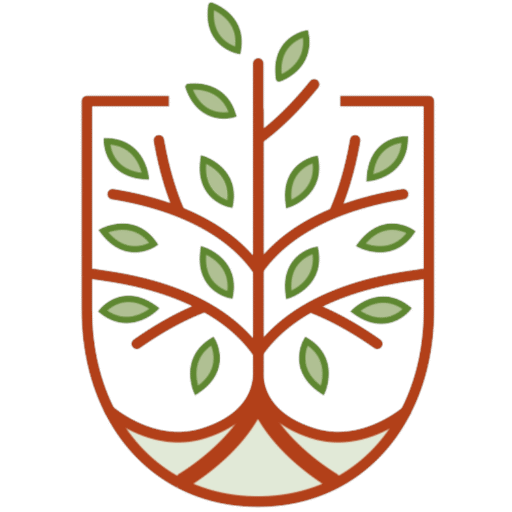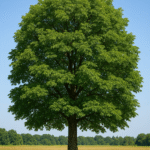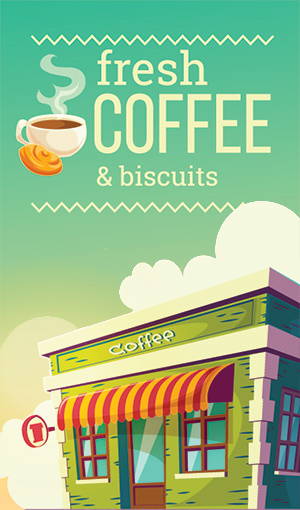Aufforstungen stehen heute unter mehrfacher Belastung: Wildverbiss, Klimastress und steigende Pflanzkosten erhöhen das Risiko, dass Investitionen in junge Bäume verloren gehen. Schutzsysteme sind deshalb wichtiger denn je, um den Waldumbau erfolgreich voranzubringen.
Doch eine andere Gefahr wird oft unterschätzt: Plastikmüll im Wald. Viele der bisher eingesetzten Kunststoffhüllen zerfallen über die Jahre und belasten Böden, Wasser und Tiere. Damit entsteht ein Problem, das weit über die eigentliche Schutzfunktion hinausgeht.
Warum herkömmliche Kunststoffhüllen problematisch sind
Der Einsatz klassischer Plastikhüllen bringt gleich mehrere Nachteile mit sich:
- Mikroplastik im Boden: Mit der Zeit zersetzen sich die Hüllen in kleine Fragmente, die im Waldboden verbleiben und dort schwer abbaubar sind. Das beeinträchtigt Bodenleben und Nährstoffkreisläufe.
- Rückbaukosten: Kunststoffhüllen müssen nach einigen Jahren aufwendig entfernt werden. Das bedeutet zusätzlichen Personal- und Maschinenaufwand.
- Entsorgungsproblematik: Selbst wenn die Hüllen eingesammelt werden, bleibt die Frage der Entsorgung. Nicht selten bleiben Reste auf der Fläche zurück und werden so dauerhaft zum Müll im Wald.
Für Waldbesitzer:innen bedeutet das: Ein scheinbar günstiger Schutz kann langfristig teurer und ökologisch schädlicher sein, als auf den ersten Blick gedacht.
Was bedeutet „biologisch abbaubar“ im forstlichen Kontext?
Der Begriff „biologisch abbaubar“ klingt klar, ist in der Praxis aber vielschichtig.
- Definition: Nach DIN/EN-Normen gilt ein Material als biologisch abbaubar, wenn es innerhalb eines festgelegten Zeitraums von Mikroorganismen vollständig zu Wasser, CO₂ und Biomasse zersetzt wird.
- Unterschied: Bio-basiert heißt lediglich, dass ein Material aus nachwachsenden Rohstoffen stammt – es kann trotzdem beständig wie Kunststoff bleiben. Biologisch abbaubar dagegen bedeutet, dass das Material tatsächlich im Boden verschwindet.
- Praxis im Wald: Entscheidend sind reale Bedingungen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und das Bodenleben. Nur wenn eine Hülle unter diesen Bedingungen zerfällt, ist sie für den forstlichen Alltag geeignet.
Vorteile biologisch abbaubarer Wuchshüllen
Für den Boden
- Kein Eintrag von Kunststoff oder Mikroplastik
- Schonung der Bodenorganismen und des natürlichen Stoffkreislaufs
Für den Rückbau
- Kein Sammeln, Transportieren oder Entsorgen nötig
- Weniger Maschinen- und Personaleinsatz → geringere Kosten
Für den Arbeitsaufwand
- Schneller Aufbau möglich
- Kein zweiter Arbeitsgang für Demontage erforderlich
- Mehr Planungssicherheit, da der Schutz nach der Wirkdauer einfach verschwindet
Für die Pflanze
- Schutz in der sensiblen Anwuchsphase
- Stabiles Mikroklima innerhalb der Hülle unterstützt Wachstum und Überlebensrate
Praxisbeispiele aus der Entwicklung
Inzwischen gibt es Schutzsysteme, die bewusst auf Naturmaterialien setzen und sich vollständig im Wald zersetzen – ganz ohne Rückbau und Plastikrückstände. Ein Beispiel sind die Tree Shield Einzelschutzhüllen. Sie bestehen laut Hersteller aus nachwachsenden Rohstoffen, sind 100 % biologisch abbaubar und bieten gleichzeitig eine lange Schutzdauer von bis zu 12 Jahren. Zudem lassen sie sich einfach montieren und benötigen keinen späteren Abtransport, was sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile für die forstliche Praxis schafft.
Fazit
Biologisch abbaubare Wuchshüllen sind kein kurzfristiger Trend, sondern eine notwendige Antwort auf die ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Wald.
Wer heute aufforstet, sollte nicht nur an den Schutz der jungen Pflanzen denken, sondern auch an die Zukunft der Böden und Ökosysteme. Denn: Ein nachhaltiger Waldumbau gelingt nur, wenn auch die Hilfsmittel umweltverträglich sind.